
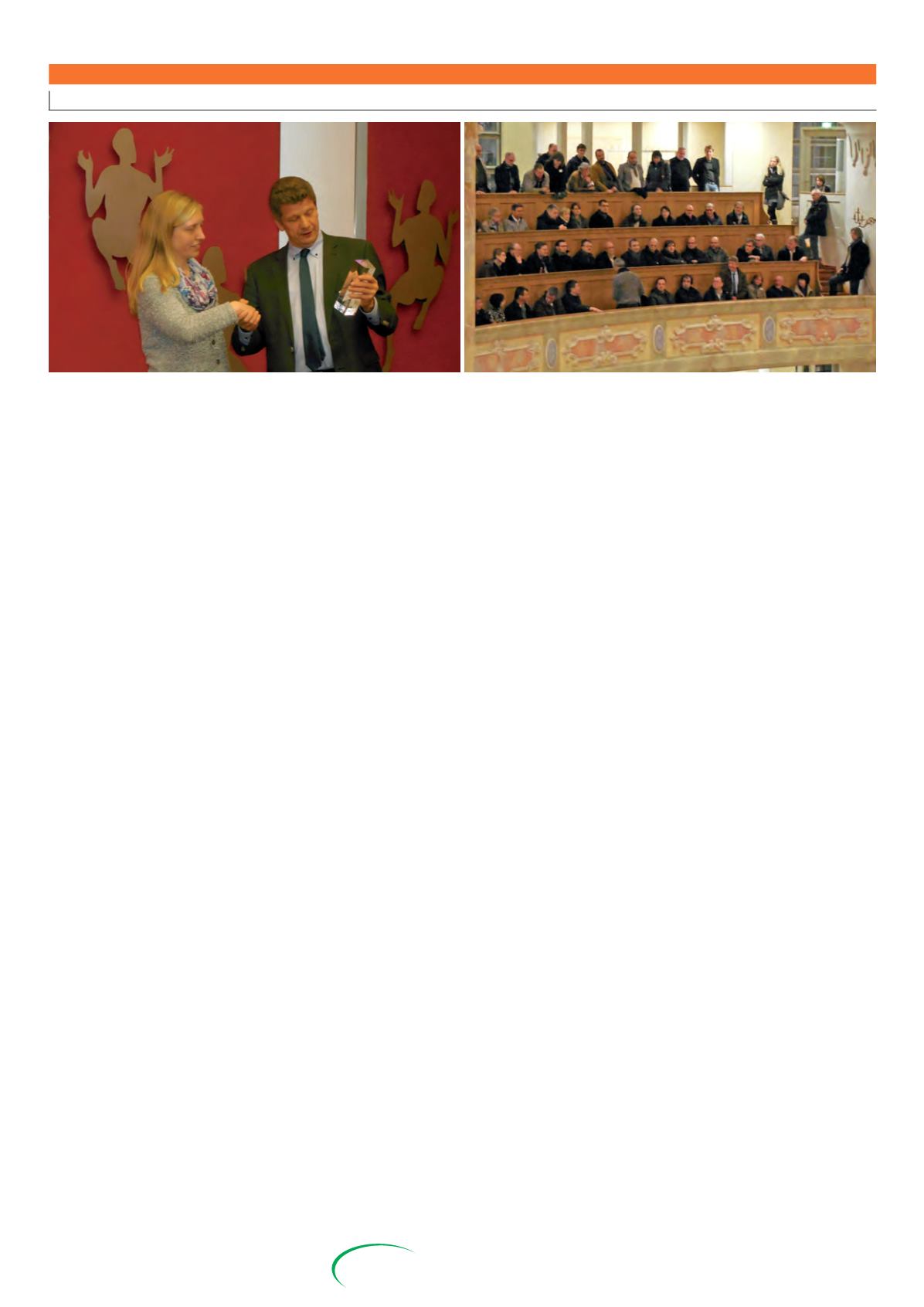
Der WTA-Preis 2015 wurde durch den Präsi-
denten der WTAe. V., Prof. Dr.-Ing. Harald Gar-
recht an Frau Daniela Jaschke, BA, für ihre Ba-
chelorarbeit „Lebensdauerbeeinflussende Fak-
toren im Bereich neuer Reetdachkonstruktionen“
verliehen (siehe Bild oben links).
Die Jury war sich einig, dass sich die Ar-
beit von Frau Jaschke in besonderer Weise für
den WTA-Preis auszeichnet. Am Beispiel der
Arbeit werde die Vielschichtigkeit eines zu-
erst vordergründig einfachen, traditionellen
Themas deutlich. In der Begründung der Jury
heißt es u. a.: „Die Bewahrung traditioneller
Bautechniken mit Naturmaterial wie die Reet-
dachkonstruktionen hat nicht nur aus Aspekten
des Denkmalschutzes Aktualität, sondern Kon-
struktion, bauphysikalische, bauchemische und
biologische Komponenten sowie Tendenzen
der sozialen und klimatischen Veränderungen
bewirken, dass sich traditionelle Reetdach-
konstruktionen heute anders verhalten. Frau
Jaschke hat alle diese Aspekte erkannt und in
ihrer Arbeit gewürdigt.“
Nach der Preisverleihung folgten die Berichte
aus den Referaten.
Am Abend fand der traditionelle WTA-Event
statt. Es begann mit einer Sonderführung auf
die Empore der Frauenkirche (siehe Bild oben
rechts). Herr Dipl.-Ing Gottschlich, Stiftung
Frauenkirche Dresden, erläuterte in Kooperati-
on mit Prof. Dr.-Ing. Lauckner und Prof. Dr.-Ing.
Garrecht den Gästen die bauphysikalischen und
raumklimatischen Problemstellungen und die
Lösungskonzepte, die sich in den Jahren nach
der Weihe 2005 der wiederaufgebauten Frauen-
kirche ergeben haben.
Der erste Tag schloss mit kulinarischen Ge-
nüssen in der fantastischen Atmosphäre des Re-
staurants Pulverturm.
Am zweiten Tag wurde das WTA-Kolloquium
durchgeführt. Das Leitthema des WTA-Kolloqui-
ums „Herausforderung Raumklima in Museen, Bi-
bliotheken, Archiven und Depots im historischen
Baubestand“ stieß in Dresden auf großes Inte-
resse. Nahezu 140 Zuhörer folgten gespannt den
Vorträgen, die sich verschiedenen Aspekten rund
um Klima und Klimastabilität widmeten (siehe
Bild auf S. 59).
Die Vorträge im ersten Veranstaltungsblock
befassten sich mit den bestehenden Anforderun-
gen des Kunstgutes an das Raumklima und den
vorgegebenen Zielen der Konservierung.
Block 1: Anforderungen des Kunstgutes
– Vortrag 1: Prof. Dr. Andreas Schulze, HFBK
Dresden, Klimatische Umgebungsbedin-
gungen für Kunst- und Kulturgut aus kon-
servatorisch-restauratorischer Sicht
– Vortrag 2: Dipl.-Ing. Michael John, Staat-
liche Kunstsammlungen Dresden, Anforde-
rungen an das Raumklima in Museen
– Vortrag 3: Dr.-Ing. Ralf Kilian, Dipl.-Rest.
Lars Klemm, IBP Holzkirchen, Klimaanfor-
derungen für Depots und Archive
– Vortrag 4: Dipl.-Ing. Wulf Eckermann,
Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten Berlin-Brandenburg, Das Kunstobjekt
im musealen Umfeld von Klima, Licht und
Schadstoffen
Schwerpunkt des zweiten Veranstaltungsblocks
bildete die Wechselwirkung zwischen Museums
objekt und dem dabei vorherrschenden Klima.
Block 2: Klimatoleranz, Einwirkung und Ma-
terialverhalten, Konservierung
– Vortrag 5: Dipl.-Rest. Andreas Weiß,
TU München, Lehrstuhl für Restaurierung,
Kunsttechnologie und Konservierungs
wissenschaft, Feldstudie zur Klimatoleranz
gefasster Leinwand- und Holzoberflächen
an Kulturgütern
– Vortrag 6: Dipl.-Ing. Simone Reeb,
IWB Universität Stuttgart, Raumklima
induziertes Formänderungsverhalten
konservierter Oberflächen
– Vortrag 7: Dr. Thomas Warscheid, LBW-Bio-
consult Oldenburg, Bauklima und mikro-
bielle Schadensprozesse
In einem dritten Veranstaltungsblock wurden die
Themen des Klimamonitoring und die Bewertung
raumklimatischer Beanspruchungen historischer
Raumoberflächen und der Museumsausstattung
erläutert.
Block 3: Bewerten und Planen auf der Basis
von Beobachtung, Monitoring und Simulation
– Vortrag 8: Dr. Bill Wei, Cultural Heritage
Agency of the Netherlands, Amsterdam,
Energie und Kulturerbe − die Suche nach
einem Gleichgewicht zwischen Technik
und Kulturwert
– Vortrag 9: Prof. Dr.-Ing. John Grunewald,
IBK TU Dresden, Neue Anforderungen an
Planungswerkzeuge für Gebäude mit be-
sonderen Raumklimabedingungen
– Vortrag 10: Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter
Leimer, HAWK Hildesheim/BBS INTER
NATIONAL, Ingenieurmäßige Entwicklung
von Klimakonzepten für Museen am
Beispiel des Herzog-Anton-Ulrich-Museums
in Braunschweig
– Vortrag 11: Dipl.-Ing. Oliver Hahn, IBW
Weimar, Raumklimatische Untersuchungen
im Neuen Museum Weimar
Im vierten und letzten Veranstaltungsblock stand
die Demonstration von Fallbeispielen im Mittel-
punkt, die sich mit den Möglichkeiten der Klima-
stabilisierung in historischen Räumen zur Ver-
besserung der raumklimatischen Verhältnisse ge-
mäß musealer Anforderungen auseinandersetzen.
Block 4: Konzeptbeispiele zur Raumklima-
stabilisierung und präventiven Konservie-
rung in Museen
– Vortrag 12: Dr.-Ing. Peter Vogel, INNIUS
GTD Dresden, Grünes Gewölbe – Realisie-
rung stabiler Raumklimaverhältnisse –
vom Makro- bis zum Mikroklima
– Vortrag 13: Dipl.-Ing. Thomas Löther, IDK
Dresden, Raumklimastabilisierung auf low-
tech Basis – Beispiele Museum Waldenburg
und Kloster St. Marienthal
– Vortrag 14: Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht,
IWB/MPA Universität Stuttgart, Museum
Haus Dix in Hemmenhofen – wieviel Tech-
nik muss oder darf denn sein?
Aufgrund der hervorragenden Unterstützung
durch das Institut für Diagnostik und Konser-
vierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-
Anhalt e.V. konnte die WTA e.V. den Mitgliedern,
Gästen und Referenten zwei gelungene Tage
voller interessanter Veranstaltungen und Be-
gegnungen im besonderen Ambiente des Stän-
dehauses sowie der imposanten Frauenkirche in-
mitten all der architektonischen Bauwerke und
dem Flair der Elbelandschaft von Dresden – dem
Elbflorenz des Nordens − bieten.
Bilder: Marc Ellinger (WTA)
Beitrag: Kornelia Horn (WTA)
WTA-Informationen
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
Schützen & Erhalten · Juni 2015 · Seite 60
















